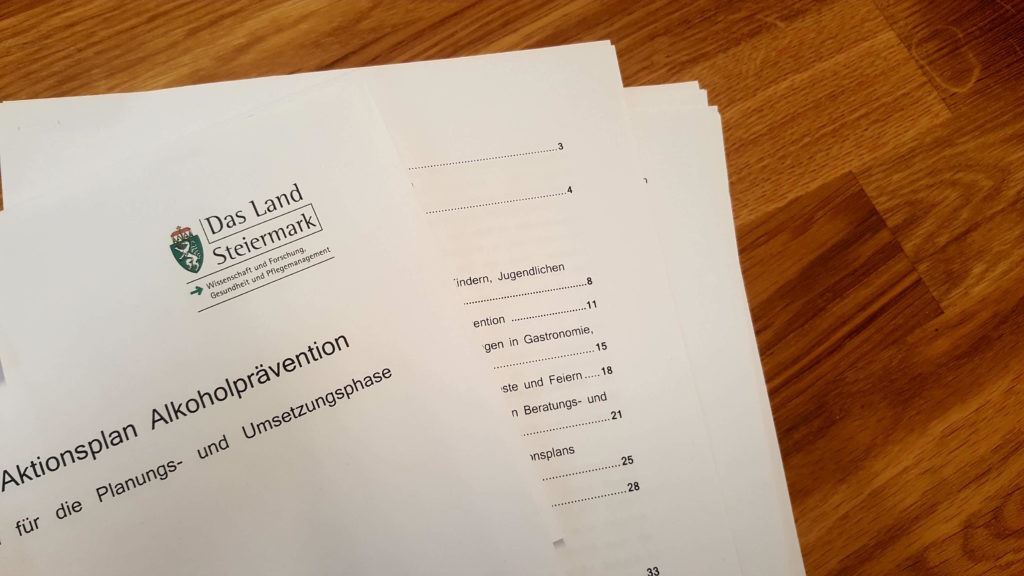Alkoholbericht Steiermark: Teil 2 – Alkoholkonsum der steirischen Schülerinnen und Schüler
Der Alkoholbericht des Gesundheitsfonds Steiermark bietet aktuelle Informationen zum Alkoholkonsum und dessen Folgen in der Steiermark. Die Daten und Fakten […]